Who the f*ck is Papa Schlumpf?
In meinem Traum bin ich in einer Kunstgalerie und stehe vor einem Gemälde von Salvador Dalì auf dem irgendetwas zerfließt. Dankenswerter Weise erhalte ich eine fachkundige Erklärung zu Farbwahl, Perspektive und kunstgeschichtlicher Bedeutung eben dieses Gemäldes, und zwar von niemand geringerem als Papa Schlumpf, der sich klugscheissernd zwischen mich und das Gemälde geschoben hat. Ich erwache und hänge kurz dem Gedanken über meine derzeitige psychische Verfassung nach, der aber schnell von einem mittelschweren Kulturschock beiseite geschoben wird. Über mir erblicke ich Wellblech, und über die Lehmwand meiner Kammer hinweg höre ich die Stimmen von gefühlten 34 Kindern und einigen Erwachsenen, die sich, in ihrer lokalen Stammessprache Kisambaa schnatternd, über ihren morgendlichen Tee hermachen.
 Durch das kleine Dorf Bombo Majimoto in den nördlichen Usambara-Bergen fließt so gut wie kein Geld. Die Menschen leben von Mais- und Reisanbau, halten sich einige Ziegen, Schafe und Hühner. Sie bauen keine cash crops an, also Agrarprodukte, die sich gewinnbringend verkaufen ließen. „Wenn einer bei uns krank wird, bitten wir einen Verwandten in der Stadt uns Geld zu schicken,“ sagt mein Gastgeber. Dabei geht es dann um Beträge von zwei oder drei Euro, die über Genesung oder Leid entscheiden. Gemeinsam besuchen wir seinen Onkel, der in einer kleinen Hütte auf einem der umliegenden Hügel lebt. Er wird langsam blind. Seine Kinder sind bis auf eines gestorben, und sein verbleibender Sohn, selber weit über vierzig Jahre, schafft es gerade so, ihm in harten Zeiten einen Teller Reis vorbeizubringen. Während wir vor seinem Haus sitzen zähle ich die Ziegen, die an den Pfosten des Vordaches angebunden stehen. Ich komme auf sechs ausgewachsene Tiere und zwei Zicklein. Weiter besitzt dieser Mann nichts.
Durch das kleine Dorf Bombo Majimoto in den nördlichen Usambara-Bergen fließt so gut wie kein Geld. Die Menschen leben von Mais- und Reisanbau, halten sich einige Ziegen, Schafe und Hühner. Sie bauen keine cash crops an, also Agrarprodukte, die sich gewinnbringend verkaufen ließen. „Wenn einer bei uns krank wird, bitten wir einen Verwandten in der Stadt uns Geld zu schicken,“ sagt mein Gastgeber. Dabei geht es dann um Beträge von zwei oder drei Euro, die über Genesung oder Leid entscheiden. Gemeinsam besuchen wir seinen Onkel, der in einer kleinen Hütte auf einem der umliegenden Hügel lebt. Er wird langsam blind. Seine Kinder sind bis auf eines gestorben, und sein verbleibender Sohn, selber weit über vierzig Jahre, schafft es gerade so, ihm in harten Zeiten einen Teller Reis vorbeizubringen. Während wir vor seinem Haus sitzen zähle ich die Ziegen, die an den Pfosten des Vordaches angebunden stehen. Ich komme auf sechs ausgewachsene Tiere und zwei Zicklein. Weiter besitzt dieser Mann nichts.
 Am späten Nachmittag kommen wir zurück ins Dorf. Die Hütten sind genauso rotbraun wie der Boden, wen wundert´s, sind sie doch aus ebendiesem Lehm gebaut. Vor einigen dieser Hütten sitzen jetzt Frauen und Kinder, die die Körner von Maiskolben pulen und auf einen Haufen werfen. Später wird das zu Mehl gestampft und anschließend zu Ugali, dem typisch ostafrikanischen Bauchfüller verkocht. Dazu gibt es Bohnen und ein bisschen Blattgemüse. Den Mais bauen sie selber an, frühmorgens mit der Hacke auf dem Feld. Man verdient sich im Wortsinne seine Mahlzeit durch harte Arbeit. Die Leute essen das, was sie angebaut haben. Punkt. Ganz sicher könnte ich hier keine Woche überleben.
Am späten Nachmittag kommen wir zurück ins Dorf. Die Hütten sind genauso rotbraun wie der Boden, wen wundert´s, sind sie doch aus ebendiesem Lehm gebaut. Vor einigen dieser Hütten sitzen jetzt Frauen und Kinder, die die Körner von Maiskolben pulen und auf einen Haufen werfen. Später wird das zu Mehl gestampft und anschließend zu Ugali, dem typisch ostafrikanischen Bauchfüller verkocht. Dazu gibt es Bohnen und ein bisschen Blattgemüse. Den Mais bauen sie selber an, frühmorgens mit der Hacke auf dem Feld. Man verdient sich im Wortsinne seine Mahlzeit durch harte Arbeit. Die Leute essen das, was sie angebaut haben. Punkt. Ganz sicher könnte ich hier keine Woche überleben.
Am nächsten Morgen treten sämtliche Kinder des Haushalts an (ich zähle 9) um ihre Dosis Wurmkur einzunehmen. Ich habe Medikamente aus der Stadt mitgebracht. Anschließend spielen wir ein bisschen auf-der-Matte-herumsitzen-und-den-Weißen-begaffen, ein besonders schönes Spiel. Ich denke, in Deutschland werde ich aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit bald an Persönlichkeitsschwund erkranken. Der älteste Sohn trägt ein T-Shirt auf dessen Vorderseite „Imam Hussein (A.S.) hat den Islam gerettet“ steht, auf der Rückseite „Warum hat man Imam Hussein (A.S.) umgebracht?“. Mir entgeht die Bedeutung dieser Botschaft, aber nicht die Tatsache, dass, nach Schelte der Mutter sich zu waschen und die Kleider zu wechseln, der jüngere Bruder mit eben jenem T-Shirt herumläuft.
 Als ich nach einigen Tagen aufbreche, verabschiede ich mich nicht, so, wie man mir geraten hatte. Es gäbe zu viel Glauben an Hexerei und so, da sei es besser, die Leute wüssten nicht, wann ich mich wo auf den Weg mache. Also mache ich kein Trara aus meinem Aufbruch, sondern sage schlicht, ich fahre mal eben in die nächste Ortschaft. Bis später also Leute. Ein Bruder oder Schwager fährt mich mit dem Moped stundenlang durch die Bergdörfer bis in die nächste Stadt. Am Abend des nächsten Tages komme ich in Daressalam an. Oh stinkender Großstadtmoloch, du hast mich wieder.
Als ich nach einigen Tagen aufbreche, verabschiede ich mich nicht, so, wie man mir geraten hatte. Es gäbe zu viel Glauben an Hexerei und so, da sei es besser, die Leute wüssten nicht, wann ich mich wo auf den Weg mache. Also mache ich kein Trara aus meinem Aufbruch, sondern sage schlicht, ich fahre mal eben in die nächste Ortschaft. Bis später also Leute. Ein Bruder oder Schwager fährt mich mit dem Moped stundenlang durch die Bergdörfer bis in die nächste Stadt. Am Abend des nächsten Tages komme ich in Daressalam an. Oh stinkender Großstadtmoloch, du hast mich wieder.
 Durch das kleine Dorf Bombo Majimoto in den nördlichen Usambara-Bergen fließt so gut wie kein Geld. Die Menschen leben von Mais- und Reisanbau, halten sich einige Ziegen, Schafe und Hühner. Sie bauen keine cash crops an, also Agrarprodukte, die sich gewinnbringend verkaufen ließen. „Wenn einer bei uns krank wird, bitten wir einen Verwandten in der Stadt uns Geld zu schicken,“ sagt mein Gastgeber. Dabei geht es dann um Beträge von zwei oder drei Euro, die über Genesung oder Leid entscheiden. Gemeinsam besuchen wir seinen Onkel, der in einer kleinen Hütte auf einem der umliegenden Hügel lebt. Er wird langsam blind. Seine Kinder sind bis auf eines gestorben, und sein verbleibender Sohn, selber weit über vierzig Jahre, schafft es gerade so, ihm in harten Zeiten einen Teller Reis vorbeizubringen. Während wir vor seinem Haus sitzen zähle ich die Ziegen, die an den Pfosten des Vordaches angebunden stehen. Ich komme auf sechs ausgewachsene Tiere und zwei Zicklein. Weiter besitzt dieser Mann nichts.
Durch das kleine Dorf Bombo Majimoto in den nördlichen Usambara-Bergen fließt so gut wie kein Geld. Die Menschen leben von Mais- und Reisanbau, halten sich einige Ziegen, Schafe und Hühner. Sie bauen keine cash crops an, also Agrarprodukte, die sich gewinnbringend verkaufen ließen. „Wenn einer bei uns krank wird, bitten wir einen Verwandten in der Stadt uns Geld zu schicken,“ sagt mein Gastgeber. Dabei geht es dann um Beträge von zwei oder drei Euro, die über Genesung oder Leid entscheiden. Gemeinsam besuchen wir seinen Onkel, der in einer kleinen Hütte auf einem der umliegenden Hügel lebt. Er wird langsam blind. Seine Kinder sind bis auf eines gestorben, und sein verbleibender Sohn, selber weit über vierzig Jahre, schafft es gerade so, ihm in harten Zeiten einen Teller Reis vorbeizubringen. Während wir vor seinem Haus sitzen zähle ich die Ziegen, die an den Pfosten des Vordaches angebunden stehen. Ich komme auf sechs ausgewachsene Tiere und zwei Zicklein. Weiter besitzt dieser Mann nichts.  Am späten Nachmittag kommen wir zurück ins Dorf. Die Hütten sind genauso rotbraun wie der Boden, wen wundert´s, sind sie doch aus ebendiesem Lehm gebaut. Vor einigen dieser Hütten sitzen jetzt Frauen und Kinder, die die Körner von Maiskolben pulen und auf einen Haufen werfen. Später wird das zu Mehl gestampft und anschließend zu Ugali, dem typisch ostafrikanischen Bauchfüller verkocht. Dazu gibt es Bohnen und ein bisschen Blattgemüse. Den Mais bauen sie selber an, frühmorgens mit der Hacke auf dem Feld. Man verdient sich im Wortsinne seine Mahlzeit durch harte Arbeit. Die Leute essen das, was sie angebaut haben. Punkt. Ganz sicher könnte ich hier keine Woche überleben.
Am späten Nachmittag kommen wir zurück ins Dorf. Die Hütten sind genauso rotbraun wie der Boden, wen wundert´s, sind sie doch aus ebendiesem Lehm gebaut. Vor einigen dieser Hütten sitzen jetzt Frauen und Kinder, die die Körner von Maiskolben pulen und auf einen Haufen werfen. Später wird das zu Mehl gestampft und anschließend zu Ugali, dem typisch ostafrikanischen Bauchfüller verkocht. Dazu gibt es Bohnen und ein bisschen Blattgemüse. Den Mais bauen sie selber an, frühmorgens mit der Hacke auf dem Feld. Man verdient sich im Wortsinne seine Mahlzeit durch harte Arbeit. Die Leute essen das, was sie angebaut haben. Punkt. Ganz sicher könnte ich hier keine Woche überleben. Am nächsten Morgen treten sämtliche Kinder des Haushalts an (ich zähle 9) um ihre Dosis Wurmkur einzunehmen. Ich habe Medikamente aus der Stadt mitgebracht. Anschließend spielen wir ein bisschen auf-der-Matte-herumsitzen-und-den-Weißen-begaffen, ein besonders schönes Spiel. Ich denke, in Deutschland werde ich aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit bald an Persönlichkeitsschwund erkranken. Der älteste Sohn trägt ein T-Shirt auf dessen Vorderseite „Imam Hussein (A.S.) hat den Islam gerettet“ steht, auf der Rückseite „Warum hat man Imam Hussein (A.S.) umgebracht?“. Mir entgeht die Bedeutung dieser Botschaft, aber nicht die Tatsache, dass, nach Schelte der Mutter sich zu waschen und die Kleider zu wechseln, der jüngere Bruder mit eben jenem T-Shirt herumläuft.
 Als ich nach einigen Tagen aufbreche, verabschiede ich mich nicht, so, wie man mir geraten hatte. Es gäbe zu viel Glauben an Hexerei und so, da sei es besser, die Leute wüssten nicht, wann ich mich wo auf den Weg mache. Also mache ich kein Trara aus meinem Aufbruch, sondern sage schlicht, ich fahre mal eben in die nächste Ortschaft. Bis später also Leute. Ein Bruder oder Schwager fährt mich mit dem Moped stundenlang durch die Bergdörfer bis in die nächste Stadt. Am Abend des nächsten Tages komme ich in Daressalam an. Oh stinkender Großstadtmoloch, du hast mich wieder.
Als ich nach einigen Tagen aufbreche, verabschiede ich mich nicht, so, wie man mir geraten hatte. Es gäbe zu viel Glauben an Hexerei und so, da sei es besser, die Leute wüssten nicht, wann ich mich wo auf den Weg mache. Also mache ich kein Trara aus meinem Aufbruch, sondern sage schlicht, ich fahre mal eben in die nächste Ortschaft. Bis später also Leute. Ein Bruder oder Schwager fährt mich mit dem Moped stundenlang durch die Bergdörfer bis in die nächste Stadt. Am Abend des nächsten Tages komme ich in Daressalam an. Oh stinkender Großstadtmoloch, du hast mich wieder.lekke - 14. Sep, 18:13




 Die ersten verlassen die Diskussionsrunde, stecken die gemeinsam benutzten Werkzeuge zurück in die Tüte und stellen ihre Schuhe auf der Straße auf. Ich gehe mit vor und setze mich mit A. auf einen der viereckigen Betonkübeln am Straßenrand, in denen wohl mal Blumen wachsen sollten, die man aber stattdessen mit ihrer undefinierten staubigen Füllung und ohne Blumen dem ergrauenden Schicksal der Stadt überlassen hat. Es ist bereits halb zwölf vormittags, und A. eröffnet mir, dass es sich nicht mehr lohnen würde für ihn, jetzt in Rotation zu gehen. Er geht wie jeden Tag kurz vor eins in die Moschee, gemeinsam mit H. und M., zum Mittagsgebet. Später dann wieder um vier Uhr nachmittags. Diese Zeiten geben vor, wann er Schuhe verkaufen kann und wann er sich vor seinem Gott verneigt.
Die ersten verlassen die Diskussionsrunde, stecken die gemeinsam benutzten Werkzeuge zurück in die Tüte und stellen ihre Schuhe auf der Straße auf. Ich gehe mit vor und setze mich mit A. auf einen der viereckigen Betonkübeln am Straßenrand, in denen wohl mal Blumen wachsen sollten, die man aber stattdessen mit ihrer undefinierten staubigen Füllung und ohne Blumen dem ergrauenden Schicksal der Stadt überlassen hat. Es ist bereits halb zwölf vormittags, und A. eröffnet mir, dass es sich nicht mehr lohnen würde für ihn, jetzt in Rotation zu gehen. Er geht wie jeden Tag kurz vor eins in die Moschee, gemeinsam mit H. und M., zum Mittagsgebet. Später dann wieder um vier Uhr nachmittags. Diese Zeiten geben vor, wann er Schuhe verkaufen kann und wann er sich vor seinem Gott verneigt.  Nach der zweiten Gebetszeit des Nachmittags gehen wir zu „Mariedo“, einer Straßenecke an der zentralen Bushaltestelle „Posta“, wo sich einige der Jungs jeden Nachmittag niederlassen um ihre Schuhe auszulegen. Hunderte von Menschen strömen nun vorbei, die ihre Büros verlassen haben und sich nun mit den elend überfüllten Dreckschleudern von Minibussen auf den Weg in ihre Wohnviertel außerhalb des Zentrums machen. Mittags können A. und seine Kollegen hier nicht „lauern“, da sie der private Wachmann des anschließenden Business-Komplexes dann grundsätzlich vertreibt. Nachtmittags ist er entspannter, vielleicht einfach auch nur zu faul um ständig mahnend auf und ab zu stolzieren, mit tiefschwarzer Uniform, Schulterklappen und Dienstmütze eine Karikatur seiner selbst. Wir alle sind platt von dem langen Fußweg durch die Stadt, sitzen wortlos auf dem staubig-warmen Asphalt und lehnen mit dem Rücken an die Wand eines 20-stöckigen Hochhauses. Ich recke den Kopf nach hinten und sehe an der gekachelten Wand entlang nach oben in den Himmel. Ein Flugzeug wird von einer strahlend weißen Wolke verschluckt.
Nach der zweiten Gebetszeit des Nachmittags gehen wir zu „Mariedo“, einer Straßenecke an der zentralen Bushaltestelle „Posta“, wo sich einige der Jungs jeden Nachmittag niederlassen um ihre Schuhe auszulegen. Hunderte von Menschen strömen nun vorbei, die ihre Büros verlassen haben und sich nun mit den elend überfüllten Dreckschleudern von Minibussen auf den Weg in ihre Wohnviertel außerhalb des Zentrums machen. Mittags können A. und seine Kollegen hier nicht „lauern“, da sie der private Wachmann des anschließenden Business-Komplexes dann grundsätzlich vertreibt. Nachtmittags ist er entspannter, vielleicht einfach auch nur zu faul um ständig mahnend auf und ab zu stolzieren, mit tiefschwarzer Uniform, Schulterklappen und Dienstmütze eine Karikatur seiner selbst. Wir alle sind platt von dem langen Fußweg durch die Stadt, sitzen wortlos auf dem staubig-warmen Asphalt und lehnen mit dem Rücken an die Wand eines 20-stöckigen Hochhauses. Ich recke den Kopf nach hinten und sehe an der gekachelten Wand entlang nach oben in den Himmel. Ein Flugzeug wird von einer strahlend weißen Wolke verschluckt.  Im Westen des Zentrums das Marktviertel Kariakoo, benannt nach den „Carrier-Corps“, den afrikanischen Trägern, die von den späteren britischen Kolonialherren hier im Schachbrettmuster angesiedelt wurden. Das drängelnde Treiben auf der Mtaa wa Kongo, die sich am einen Ende wie ein Trichter verjüngt, so dass die Passanten, ähnlich dem Vieh im Schlachthof, an der Engstelle gezwungenermaßen auf Tuchfühlung mit den allgegenwärtigen Taschendieben gehen müssen. Sehr viel eher „mein Afrika“ als Serengeti, Kilimandscharo und Trommeln am Lagerfeuer.
Im Westen des Zentrums das Marktviertel Kariakoo, benannt nach den „Carrier-Corps“, den afrikanischen Trägern, die von den späteren britischen Kolonialherren hier im Schachbrettmuster angesiedelt wurden. Das drängelnde Treiben auf der Mtaa wa Kongo, die sich am einen Ende wie ein Trichter verjüngt, so dass die Passanten, ähnlich dem Vieh im Schlachthof, an der Engstelle gezwungenermaßen auf Tuchfühlung mit den allgegenwärtigen Taschendieben gehen müssen. Sehr viel eher „mein Afrika“ als Serengeti, Kilimandscharo und Trommeln am Lagerfeuer.  Kurz bevor wir im Stadtzentrum an jener weltberühmten Straßenecke vorbeikommen, die regelmäßige Leser dieses Blogs nun selbst im Schlaf oder wahlweise mit verbundenen Augen, geknebelt und gefesselt im Kofferraum eines Autos eingesperrt, als Hauptschauplatz der hier angesammelten Texte identifizieren würden, biegen wir scharf nach rechts ab, dann gleich wieder nach links, und fahren am Hafen entlang in Richtung der Fähre. Sie wird mich zum luftig-grünen Zipfel jenseits der „Bucht des Friedens“ übersetzen. Ein infrastruktureller Alptraum, sind die knapp 200 Meter, die mangels einer Brücke mit zwei kleinen Fährschiffen überquert werden müssen, dennoch in gewisser Hinsicht ein Segen. Jenseits dieser paar Meter indischen Ozeans ist die enge Stadt plötzlich weiter weg, als sie tatsächlich ist. Hier gibt es keinen Lärm und keinen Stau. Stattdessen Kühe, Kokospalmen, das Türkis des Ozeans im Augenwinkel, das Grün der dichten Vegetation vor mir und den ostafrikanischen Himmel blau darüber. Die Stadtverwaltung plant eifrig eine Brücke, oder sogar zwei, und am besten noch eine Unterführung (!) unter der Bucht auf die andere Seite, um dieses wertvolle Stück Land endlich an die Stadt anzuschließen. „Mji Mpya“ soll das werden, die neue Stadt. Am Reissbrett entworfen, im Computer simuliert, für die Reichen ein Geschenk, für die ländlichen Bewohner der anderen Seite das Ende ihrer ruhigen Tage. Aber für die ist die neue Stadt ja bitte auch nicht gedacht.
Kurz bevor wir im Stadtzentrum an jener weltberühmten Straßenecke vorbeikommen, die regelmäßige Leser dieses Blogs nun selbst im Schlaf oder wahlweise mit verbundenen Augen, geknebelt und gefesselt im Kofferraum eines Autos eingesperrt, als Hauptschauplatz der hier angesammelten Texte identifizieren würden, biegen wir scharf nach rechts ab, dann gleich wieder nach links, und fahren am Hafen entlang in Richtung der Fähre. Sie wird mich zum luftig-grünen Zipfel jenseits der „Bucht des Friedens“ übersetzen. Ein infrastruktureller Alptraum, sind die knapp 200 Meter, die mangels einer Brücke mit zwei kleinen Fährschiffen überquert werden müssen, dennoch in gewisser Hinsicht ein Segen. Jenseits dieser paar Meter indischen Ozeans ist die enge Stadt plötzlich weiter weg, als sie tatsächlich ist. Hier gibt es keinen Lärm und keinen Stau. Stattdessen Kühe, Kokospalmen, das Türkis des Ozeans im Augenwinkel, das Grün der dichten Vegetation vor mir und den ostafrikanischen Himmel blau darüber. Die Stadtverwaltung plant eifrig eine Brücke, oder sogar zwei, und am besten noch eine Unterführung (!) unter der Bucht auf die andere Seite, um dieses wertvolle Stück Land endlich an die Stadt anzuschließen. „Mji Mpya“ soll das werden, die neue Stadt. Am Reissbrett entworfen, im Computer simuliert, für die Reichen ein Geschenk, für die ländlichen Bewohner der anderen Seite das Ende ihrer ruhigen Tage. Aber für die ist die neue Stadt ja bitte auch nicht gedacht. 







 „Mist, jetzt haben wir vergessen Wasser zu kaufen,“ sagt C., als wir gerade aus dem dünn besiedelten Chamazi am Rande der Stadt in den Busch laufen, um die kleine Scholle zu suchen, die er und sein Cousin M. gemeinsam von ihrer Tante gekauft haben. Vor uns tut sich eine sanfte und grüne Hügellandschaft auf, und ich bereue nicht, die Einladung angenommen zu haben, die beiden zu ihrem Zukunfts-Hoffnungs-Ort zu begleiten. Das mit dem Wasser nehme ich nicht so ernst, ich prahle noch mit meiner vortrefflichen körperlichen Konstitution, was ich später kleinlaut und unter mitleidigem Schulterklopfen revidieren werde. Wir überqueren eine Senke um auf der anderen Seite das besagte Stück Land zu finden. Ihre Tante begleitet uns. Ihr Ehemann war der Besitzer und Verwalter des Landes, und hatte bereits einige Parzellen verkauft, bevor er letzten Dezember starb. Als wir ankommen torkelt sie zunächst wie betrunken durch die Hitze, bis sie sich schließlich im Schatten eines Baumes auf die verbrannte Erde wirft und vor Kummer und Schmerz schreit. Dieser einfache Acker weckt Erinnerungen in ihr, an ein gemeinsames Leben mit ihrem Mann, das erst vor so kurzer Zeit endete. Etwas unbeholfen stehen wir drei um sie herum, bis M. sie schließlich bittet, sich nicht in den Dreck zu legen, es gebe ziemlich viel garstiges Ungeziefer.
„Mist, jetzt haben wir vergessen Wasser zu kaufen,“ sagt C., als wir gerade aus dem dünn besiedelten Chamazi am Rande der Stadt in den Busch laufen, um die kleine Scholle zu suchen, die er und sein Cousin M. gemeinsam von ihrer Tante gekauft haben. Vor uns tut sich eine sanfte und grüne Hügellandschaft auf, und ich bereue nicht, die Einladung angenommen zu haben, die beiden zu ihrem Zukunfts-Hoffnungs-Ort zu begleiten. Das mit dem Wasser nehme ich nicht so ernst, ich prahle noch mit meiner vortrefflichen körperlichen Konstitution, was ich später kleinlaut und unter mitleidigem Schulterklopfen revidieren werde. Wir überqueren eine Senke um auf der anderen Seite das besagte Stück Land zu finden. Ihre Tante begleitet uns. Ihr Ehemann war der Besitzer und Verwalter des Landes, und hatte bereits einige Parzellen verkauft, bevor er letzten Dezember starb. Als wir ankommen torkelt sie zunächst wie betrunken durch die Hitze, bis sie sich schließlich im Schatten eines Baumes auf die verbrannte Erde wirft und vor Kummer und Schmerz schreit. Dieser einfache Acker weckt Erinnerungen in ihr, an ein gemeinsames Leben mit ihrem Mann, das erst vor so kurzer Zeit endete. Etwas unbeholfen stehen wir drei um sie herum, bis M. sie schließlich bittet, sich nicht in den Dreck zu legen, es gebe ziemlich viel garstiges Ungeziefer.  „Abdullah hat ein Stück von der Palme dort drüben bis zu dem Yamsbusch dort, und von dem Lehmbrocken auf der anderen Seite bis zum Wasser unten. Das heißt auf der anderen Seite ist das Stück von Patrick, und dahinter dann unseres, ungefähr bis zu dem Mangobaum da hinten.“ Das ganze sind dann etwa 30 auf 60 Fuß, und unser Maßband ist in Metern geeicht. Wasser haben wir wie gesagt keines, dafür knapp 40 Grad im Schatten, nur dass es eben keinen Schatten gibt. Ein lustiger Nachmittag steht uns bevor.
„Abdullah hat ein Stück von der Palme dort drüben bis zu dem Yamsbusch dort, und von dem Lehmbrocken auf der anderen Seite bis zum Wasser unten. Das heißt auf der anderen Seite ist das Stück von Patrick, und dahinter dann unseres, ungefähr bis zu dem Mangobaum da hinten.“ Das ganze sind dann etwa 30 auf 60 Fuß, und unser Maßband ist in Metern geeicht. Wasser haben wir wie gesagt keines, dafür knapp 40 Grad im Schatten, nur dass es eben keinen Schatten gibt. Ein lustiger Nachmittag steht uns bevor. Hoffnung lauert jedoch unten am Bach. Nachdem die eigentliche Arbeit vollbracht ist, werfen C. und M. sich ihre Hacken über die Schulter und lassen ihre Tante und mich Weichei unter einem Baum zurück. Nach wenigen Minuten kommen sie grinsend mit etwas wieder, was für mich wie Bambus aussieht. Nachdem wir aber mühsam mit den Zähnen die harte Rinde abgenagt haben gibt das zuckrig-kristalline Mark den süßen Geschmack von Wassermelone und vor allem etwas Flüssigkeit preis. Ich kann mich gerade noch zurückhalten den beiden heulend um den Hals zu fallen. Das Zuckerrohr hacken sie in etwas handlichere Stücke und verschnüren es mit der abgezogenen Rinde eines Baums für den Heimtransport. Ich staune über die beiden von neuem. Sind halt doch echte „Naturburschen“, Jungs vom Land, vom Dorf. Die Sonne und die körperliche Arbeit machen ihnen nicht die Bohne aus.
Hoffnung lauert jedoch unten am Bach. Nachdem die eigentliche Arbeit vollbracht ist, werfen C. und M. sich ihre Hacken über die Schulter und lassen ihre Tante und mich Weichei unter einem Baum zurück. Nach wenigen Minuten kommen sie grinsend mit etwas wieder, was für mich wie Bambus aussieht. Nachdem wir aber mühsam mit den Zähnen die harte Rinde abgenagt haben gibt das zuckrig-kristalline Mark den süßen Geschmack von Wassermelone und vor allem etwas Flüssigkeit preis. Ich kann mich gerade noch zurückhalten den beiden heulend um den Hals zu fallen. Das Zuckerrohr hacken sie in etwas handlichere Stücke und verschnüren es mit der abgezogenen Rinde eines Baums für den Heimtransport. Ich staune über die beiden von neuem. Sind halt doch echte „Naturburschen“, Jungs vom Land, vom Dorf. Die Sonne und die körperliche Arbeit machen ihnen nicht die Bohne aus.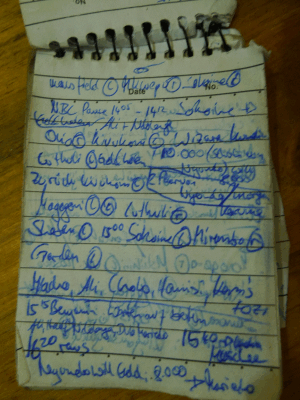
 J. war keiner von den Schuhverkäufern. Er hat mit zwei anderen Jungs einen kleinen „Buchladen“ betrieben, genaugenommen ein Stahlgitter, das mit gebrauchten Büchern vollbeladen war. Wenn sie Glück hatten, die drei, kam ein Schüler oder Student vorbei, und hat ihnen ein Geschichtsbuch oder einen Atlas abgekauft.
J. war keiner von den Schuhverkäufern. Er hat mit zwei anderen Jungs einen kleinen „Buchladen“ betrieben, genaugenommen ein Stahlgitter, das mit gebrauchten Büchern vollbeladen war. Wenn sie Glück hatten, die drei, kam ein Schüler oder Student vorbei, und hat ihnen ein Geschichtsbuch oder einen Atlas abgekauft.