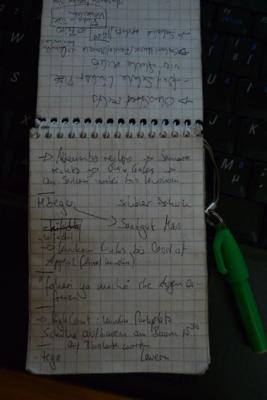Work in progress
S: [Ich habe ihnen gesagt:] Leute, so wie jetzt sitzen wir hier schon seit langer Zeit. Das Leben ist nicht besser geworden. Oder? Und jeder Einzelne hier sucht sich sein eigenes kleines Geschäft.
Das worum ich bitte, ist, dass wir ein gemeinsames Konto eröffnen. Das heißt, wir so wie wir sind, als Gruppe. Wir eröffnen das, und dann wenn wir Geld einnehmen, legen wir es auf die Bank. Weil das könnte uns auch helfen zum Beispiel einmal einen Kredit zu bekommen.[…]
Aus dem Grund, dass später, nach einigen Jahren, jeder Einzelne von uns ein gutes Kapital hätte. Wenn wir jetzt gleich gehen und uns so zusammenschließen.
An diesem Tag haben nur wenige gesagt „in Ordnung“. Die meisten haben einfach nicht geantwortet. Wir hatten ausgemacht, dass sie an einem anderen Tag ihre Entscheidung geben sollten, am Samstag.
AM: Das heißt an diesem Tag seid ihr zusammengesessen aber ohne…
S: … ohne eine Antwort zu bekommen. Aber einige wenige haben die Sache unterstützt. Zum Beispiel C., M. hat es unterstützt, wer noch, S. hat es unterstützt […] Wir waren vielleicht fünf Leute die dafür waren. An diesem Tag. Aber andere, es blieb die Frage offen, also, das heißt, es war nicht klar ob sie zustimmen würden oder was. Wir mussten auf jenen Samstag warten. Als Samstag kam, habe ich sie wieder daran erinnert.
Dort, Mann, als ich sie erinnerte kam nur ein großes Chaos heraus, alle redeten durcheinander. Der eine sagt das, ein anderer sagt das. Aber es waren keine guten Worte, keine Worte des Einvernehmens. Eh, keine Worte des Einvernehmens. Jeder einzelne… redet, aber er redet nicht konstruktiv, sondern nur destruktiv.
Da wurde mir klar, na sowas, die Leute wollen das nicht. Die Leute sagten, „Ah! Mann, wenn ihr sowas anfangen wollt, dann fangt nur an. Ich, Mann, mein Geld, wenn ich Geld bekomme, dann ess´ ich das so wie es kommt, wenn ich nichts bekomme, nun denn. Diese Angelegenheit Geld auf der Bank anzulegen, das ist nicht mein Ding.“
Diese Angelegenheit, ehrlich gesagt, ist in diesem Moment schon gestorben. Sie starb genau an diesem Ort. Bis heute haben wir nicht mehr darüber geredet.
Weil ich gesehen hab´, hier, Mann, sind die Möglichkeiten so etwas zu machen sehr gering. Und das alles kommt daher, weil wir keinen Zusammenhalt haben. Wenn die Leute uns so sehen, können sie sagen, diese Leute dort sind zusammen. Weil wir alle das gleiche Business machen, am gleichen Ort. Wenn uns die Leute sehen, so wie wenn ein Gast zu uns kommen würde und sagt, diese Leute sind zusammen und sie verstehen sich…
AM: #So wie ich, ich dachte das…#
S: #Sie verstehen sich, so wie Du#, sie verstehen sich. Aber hier ist kein Klima in dem wir uns gegenseitig helfen. Also kein Klima in dem wir uns gegenseitig gute Ideen geben. […]
Deswegen, diese Angelegenheit, sie... sie ist dort gestorben. Genau dort. Ich kann das auch nicht noch einmal ansprechen. Das war schon das zweite Mal dass ich so etwas versucht habe.
AM: Das war schon das zweite Mal?
S: Eh, das war schon das zweite Mal. Das erste Mal als ich das ansprach hat kein einziger auch nur ein gutes Wort gesagt.
AM: Aber, die, die da nicht mitmachen wollten, haben sie dir einen Grund genannt?
S: Ah-ah. Ihre Gründe, sie konnten keine Gründe angeben. Weil, ein Mensch zeigt es schon wenn er etwas ablehnt, mit den Worten die er benutzt.
Der eine sagt dir „Ah! Ich, Mann, ich mach da nicht mit. Eh, ich mach da nicht mit. Wenn ich Probleme hab´ dann weiß ich das schon selbst. Wenn ich irgendwas anderes hab´, dann weiß ich das auch selbst. Mein Geld das steck ich in meine eigene Tasche.“
Deswegen, diese Sache, diese Sache mit der Bank, ich kann das nicht nochmal machen.
Aber eine andere Sache, die mir auf dem Herzen liegt, wir verpassen hier… wir verstehen nicht… ich dachte, der größte Teil der Leute dort, wir kommen doch alle aus der gleichen Gegend.
AM: Ich weiß, sogar aus dem gleichen Dorf…
S: Sogar das Dorf ist das gleiche. Also ein bisschen verstehen wir schon, was schief läuft. Weil, es ist kein Geheimnis, wenn jemand mit Leuten zusammen ist, die alle irgendwie unterschiedlich sind, das ist ein bisschen besser. Weil jeder hat seine eigenen Gedanken, deswegen. Du kannst dann, du nimmst dir die einen Gedanken, dann die anderen. Aber die Gedanken hier scheinen die gleichen zu sein wie im Dorf.
AM: Eh? Denkst du das?
S: Eh! Die Gedanken hier, die sehen genauso aus wie die aus dem Dorf, genau die gleichen. Das sind keine Stadt-Gedanken. Sie wissen nicht, ihr Leben, worüber mann nachdenken muss. […]
AM: Aber worin unterscheiden sich die Gedanken vom Dorf und die von der Stadt, was ist der Unterschied?
S: Ah, weißt du... weißt du... weißt du im Dorf, da wohnen die Leute bei ihrem Vater, oder bei ihrer Mutter. […] Selbst wenn du selber nichts anbaust, kannst du bei den Eltern mitessen. Sie essen, du isst, ok? Du isst. Das heißt, die Gedanken reichen nur soweit, nur bis zu dem Moment.
Das worum ich bitte, ist, dass wir ein gemeinsames Konto eröffnen. Das heißt, wir so wie wir sind, als Gruppe. Wir eröffnen das, und dann wenn wir Geld einnehmen, legen wir es auf die Bank. Weil das könnte uns auch helfen zum Beispiel einmal einen Kredit zu bekommen.[…]
Aus dem Grund, dass später, nach einigen Jahren, jeder Einzelne von uns ein gutes Kapital hätte. Wenn wir jetzt gleich gehen und uns so zusammenschließen.
An diesem Tag haben nur wenige gesagt „in Ordnung“. Die meisten haben einfach nicht geantwortet. Wir hatten ausgemacht, dass sie an einem anderen Tag ihre Entscheidung geben sollten, am Samstag.
AM: Das heißt an diesem Tag seid ihr zusammengesessen aber ohne…
S: … ohne eine Antwort zu bekommen. Aber einige wenige haben die Sache unterstützt. Zum Beispiel C., M. hat es unterstützt, wer noch, S. hat es unterstützt […] Wir waren vielleicht fünf Leute die dafür waren. An diesem Tag. Aber andere, es blieb die Frage offen, also, das heißt, es war nicht klar ob sie zustimmen würden oder was. Wir mussten auf jenen Samstag warten. Als Samstag kam, habe ich sie wieder daran erinnert.
Dort, Mann, als ich sie erinnerte kam nur ein großes Chaos heraus, alle redeten durcheinander. Der eine sagt das, ein anderer sagt das. Aber es waren keine guten Worte, keine Worte des Einvernehmens. Eh, keine Worte des Einvernehmens. Jeder einzelne… redet, aber er redet nicht konstruktiv, sondern nur destruktiv.
Da wurde mir klar, na sowas, die Leute wollen das nicht. Die Leute sagten, „Ah! Mann, wenn ihr sowas anfangen wollt, dann fangt nur an. Ich, Mann, mein Geld, wenn ich Geld bekomme, dann ess´ ich das so wie es kommt, wenn ich nichts bekomme, nun denn. Diese Angelegenheit Geld auf der Bank anzulegen, das ist nicht mein Ding.“
Diese Angelegenheit, ehrlich gesagt, ist in diesem Moment schon gestorben. Sie starb genau an diesem Ort. Bis heute haben wir nicht mehr darüber geredet.
Weil ich gesehen hab´, hier, Mann, sind die Möglichkeiten so etwas zu machen sehr gering. Und das alles kommt daher, weil wir keinen Zusammenhalt haben. Wenn die Leute uns so sehen, können sie sagen, diese Leute dort sind zusammen. Weil wir alle das gleiche Business machen, am gleichen Ort. Wenn uns die Leute sehen, so wie wenn ein Gast zu uns kommen würde und sagt, diese Leute sind zusammen und sie verstehen sich…
AM: #So wie ich, ich dachte das…#
S: #Sie verstehen sich, so wie Du#, sie verstehen sich. Aber hier ist kein Klima in dem wir uns gegenseitig helfen. Also kein Klima in dem wir uns gegenseitig gute Ideen geben. […]
Deswegen, diese Angelegenheit, sie... sie ist dort gestorben. Genau dort. Ich kann das auch nicht noch einmal ansprechen. Das war schon das zweite Mal dass ich so etwas versucht habe.
AM: Das war schon das zweite Mal?
S: Eh, das war schon das zweite Mal. Das erste Mal als ich das ansprach hat kein einziger auch nur ein gutes Wort gesagt.
AM: Aber, die, die da nicht mitmachen wollten, haben sie dir einen Grund genannt?
S: Ah-ah. Ihre Gründe, sie konnten keine Gründe angeben. Weil, ein Mensch zeigt es schon wenn er etwas ablehnt, mit den Worten die er benutzt.
Der eine sagt dir „Ah! Ich, Mann, ich mach da nicht mit. Eh, ich mach da nicht mit. Wenn ich Probleme hab´ dann weiß ich das schon selbst. Wenn ich irgendwas anderes hab´, dann weiß ich das auch selbst. Mein Geld das steck ich in meine eigene Tasche.“
Deswegen, diese Sache, diese Sache mit der Bank, ich kann das nicht nochmal machen.
Aber eine andere Sache, die mir auf dem Herzen liegt, wir verpassen hier… wir verstehen nicht… ich dachte, der größte Teil der Leute dort, wir kommen doch alle aus der gleichen Gegend.
AM: Ich weiß, sogar aus dem gleichen Dorf…
S: Sogar das Dorf ist das gleiche. Also ein bisschen verstehen wir schon, was schief läuft. Weil, es ist kein Geheimnis, wenn jemand mit Leuten zusammen ist, die alle irgendwie unterschiedlich sind, das ist ein bisschen besser. Weil jeder hat seine eigenen Gedanken, deswegen. Du kannst dann, du nimmst dir die einen Gedanken, dann die anderen. Aber die Gedanken hier scheinen die gleichen zu sein wie im Dorf.
AM: Eh? Denkst du das?
S: Eh! Die Gedanken hier, die sehen genauso aus wie die aus dem Dorf, genau die gleichen. Das sind keine Stadt-Gedanken. Sie wissen nicht, ihr Leben, worüber mann nachdenken muss. […]
AM: Aber worin unterscheiden sich die Gedanken vom Dorf und die von der Stadt, was ist der Unterschied?
S: Ah, weißt du... weißt du... weißt du im Dorf, da wohnen die Leute bei ihrem Vater, oder bei ihrer Mutter. […] Selbst wenn du selber nichts anbaust, kannst du bei den Eltern mitessen. Sie essen, du isst, ok? Du isst. Das heißt, die Gedanken reichen nur soweit, nur bis zu dem Moment.
lekke - 22. Nov, 16:11