Kein schöner Text, dafür mit Nachtisch
Oh oh, das wird nicht leicht. Eine Gratwanderung, eine dünne Linie auf der ich mich bewege. Links und rechts davon lauern Unverständnis, Eurozentrismus, Überheblichkeit, Depression. Aber das hier ist mein privater Blog, und ich habe ihn eröffnet um meine privaten, intimen Erlebnisse und Eindrücke in Textformen zu pressen. Auch wenn´s weh tut. Also steht mir bei, Freunde.
Es tut mir in der Seele weh zu sehen, wie meine Freunde sich Tag für Tag abrackern und doch nie, nie, nie von der Stelle kommen werden. Wie sie ihre Kinder gerade mal mit dem nötigsten versorgen und schon an ein paar Schillingen für Schulbücher scheitern. Wie sie an Krankheiten leiden, die bei uns in Deutschland mit Tabletten für ein paar-Mark-und-fufzig aus der Welt geräumt wären. Wie sie von ihren politischen Führern herabgewürdigt, von der Stadtverwaltung verjagt, von ihren Mitbürgern verachtet werden.
Es ist mir peinlich, wenn sie mich fragen, ob es bei uns in Deutschland auch Arme gibt. Ich denke an die Hartz-IV-Diskussionen und trau mich gar nicht zu sagen, dass wir vom Staat bezahlt werden, wenn auf dem Arbeitsmarkt mal nix geht. Die Armut, mit der ich hier konfrontiert bin, bereitet mir körperliche Schmerzen, schlaflose Nächte, einen Klos im Hals, einen Druck im Kopf, dass ich am liebsten zerspringen will. Dabei ist der Reichtum dieses Landes allgegenwärtig. Ich sehe eine Millionenstadt voller junger, kraftvoller Menschen, die arbeiten wollen, aber keine Chance bekommen. Wieso kommt Tansania nicht aus diesem absurden Zustand der Armut heraus?
„Maji yanafuata mkondo“ sagt man mir, das Wasser folgt dem Flusslauf. So einfach. Die Lebenswege gleichen sich. Der Vater als armer Tropf vom Dorf in die Stadt gekommen. Dort ein Leben lang geschuftet. Erst Plastiktüten auf dem Markt verkauft, später mit einem Karren die Einkäufe der Besserverdienenden durch die Stadt befördert. Gebrauchte Kinderkleider zum Verkauf durch die Straßen getragen. Oder Schuhe, Zigaretten, Rattengift. Als der Körper im Alter müde wurde eine kleine Holzbude am Straßenrand, Schuhe putzen, bis er blind wird und ihm die Zähne ausfallen. Aber was heißt hier im Alter? Die durchschnittliche Lebenserwartung in Tansania beträgt irgend so etwas wie 58 Jahre. Da spricht man bei uns noch vom „zweiten Frühling“ und plant die Weltreise, die man als junger Mensch verpasst hat. Krankenversicherung und Gesundheitsvorsorge gibt es hier nicht. „Wir sind nicht wie die wazungu, die Weißen. Wir gehen nicht zum Arzt, um mal zu sehen wie es so um die Gesundheit steht,“ sagen meine Freunde auf der Straße. Sie werden eines einfach Tages krank, vielleicht klappen sie auch komplett zusammen und sterben einfach ein paar Tage später.
„Wenn einer von uns krank wird, dann legen wir zusammen, um ihn ins Krankenhaus zu schicken.“ Das machen die Jungs aber nicht beliebig oft. „Wenn wir sehen, nach ein oder zwei Krankenhausbesuchen wird es nicht besser, legen wir zusammen für ein Busticket nach Hause ins Dorf.“ Im Dorf gibt es dann außer dem „mganga“, dem Medizinmann, ansonsten keine Behandlung mehr. Aber wenigstens ist man im Kreis der Familie. „Viele haben wir schon so nach Hause geschickt. Keiner ist wiedergekommen,“ sagte mir einmal mein Freund M. kopfschüttelnd.

Hinterhof in Tandika, Daressalam.
Erst vor einigen Tagen starb das wenige Monate alte Kind eines meiner Freunde. Ein paar Tage später das Neugeborene eines anderen Freundes. Schon das Zweite. Die Ärzte hier kennen Malaria und Antibiotika, wenn das nicht hilft, sind die Leute auf sich selbst gestellt. Ich habe noch nie so viele Leute um mich herum sterben gesehen.
Das alles macht mir Angst. Die strukturelle Armut hier lässt sich nicht mit ein paar Finanzspritzen aus der Welt schaffen. Die Armut betrifft nicht nur die Körper der Menschen, sondern auch ihren Geist. Alles dreht sich hier ums Geld. Jedes Gespräch, jeder Lebenstraum, jede soziale Beziehung hat, explizit oder nur unterschwellig, Geld zum Thema. Frauen sind bei ihrer Partnerwahl voll und ganz auf dessen finanzielle Perspektiven fixiert. Da keiner konstant Geld nach Hause schaffen kann, ist es nicht unüblich, mehrere Partner zu haben. Die Grenzen zur Prostitution sind oft fließend. Und weil tansanische Männer richtige Männer sein wollen, sind Kondome natürlich tabu für sie. Ungewollte Schwangerschaften führen zu Kindern, um die sich keiner kümmert. HIV/AIDS zerstört die Leben von Millionen Menschen. Aber das scheint den ganzen Kerlen hier egal zu sein. Tut mir leid, liebe Tansanier, aber das sind keine Folgen des Kolonialismus und das hat auch nichts mit dem kapitalistischen Weltsystem zu tun. Ihr macht euch selbst kaputt mit eurer Ignoranz.
Ich habe gesagt, es wird nicht schön diesmal. Die Fixierung auf Geld und den eigenen Vorteil zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Was am oberen Ende der Gesellschaft wie selbstsüchtige Kleptomanie aussieht, ist in der Mitte und am unteren Ende Diebstahl, Lüge, Betrug aus Angst, aus Verzweiflung, aus der Hoffnung heraus, sich einen kleinen Vorteil in dieser Schlangengrube von Gesellschaft zu verschaffen. Es herrscht das Recht des Stärkeren in Tansania.
Schön zu beobachten beispielsweise im Straßenverkehr. Ich kriege das kalte Kotzen wenn ich auf dem Weg in die Stadt von den Autos nur so gejagt werde. Wer würde es in Deutschland wagen mit dem Auto auf dem Bürgersteig zu fahren, und dann auch noch die Frechheit zu haben, Fußgänger mit der Hupe zu verscheuchen? Hier ganz alltäglich, und die Leute um mich herum sehen noch nicht mal einen Anlass, sich bei den Auto-Prolos zu beschweren. Sie sind es anscheinend gewohnt, keine Rechte zu haben. In Deutschland, so denke ich, haben wir eine Kultur, in der wir versuchen sozial schwächere irgendwie mitzutragen. Seine privilegierte Position nach außen zu kehren und sich als Macker zu geben gilt uns irgendwie als peinlich. Ich käme nie auf die Idee einen Behinderten auf der Straße auszulachen oder mich über den Nachteil eines anderen zu freuen. In Tansania dagegen gilt ein einfaches Prinzip: Der große Fisch frisst den kleinen.
Wer könnte einen Ausweg schaffen aus dem Teufelskreis aus Armut, erbärmlicher Bildung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, ungeplanten Schwangerschaften, AIDS? Wie wäre es mit der Regierung? Aber welches Interesse kann eine Regierung daran haben, ihre Bevölkerung zu bilden und zu mündigen Bürgern zu machen? Wenn die Tansanier endlich die Fußball-Zeitschriften aus der Hand legen und die Politikseiten ihrer Zeitungen lesen würden wäre das sicher nicht zum Besten der „Chama cha Mapinduzi“, der „Partei der Revolution“. Sie ist seit der Unabhängigkeit 1962 an der Macht, also seit fünfzig Jahren. Die Netzwerke in diesem Alt-Herren-Club sind etabliert und ausgebaut, da möchte keiner daran rütteln. Sie werden seit Jahrzehnten von ausländischen Finanzhilfen gespeist.
Und die desolate Lage der Bevölkerung betrifft diese Leute natürlich nicht: Ihre Kinder studieren in Oxford und Yale. Und wenn einer von ihnen krank wird, geht er nicht ins staatliche Krankenhaus und wartet fünf Stunden bis er den unterbezahlten Arzt bestechen darf, sondern fliegt nach Europa oder die USA, auf Staatskosten, versteht sich. Warum also, sollten sie etwas am Zustand ihres Landes ändern wollen? Es funktioniert doch super!
Die sambische Autorin Dambisa Moyo würde vorschlagen, den afrikanischen Regierungen den finanziellen Hahn zuzudrehen. Was als Marshall-Plan für das Nachkriegseuropa gut funktioniert hat, nämlich durch finanzielle Hilfe von außen eine nachhaltige Entwicklung zu stimulieren, geht in Afrika voll und ganz nach hinten los. Denn während der Marshall-Plan auf fünf Jahre begrenzt war, haben die afrikanischen Regierungen die Gewissheit, ohne zeitliches Limit Jahr für Jahr Millionensummen auf ihre Konten überwiesen zu bekommen. Warum also auch nur versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen? Und das Gutmenschentum in Europa und den USA wiederum denkt, wir müssten unsere sogenannte „Entwicklungshilfe“ auch noch aufstocken, um endlich die Armut für immer zu besiegen. Die einzigen die etwas davon haben, sind die Politeliten, bei den Menschen auf der Straße kommt kein einziger Cent an.
So sitzt Tansania nach fünfzig Jahren Unabhängigkeit jeden zweiten Tag im Dunkeln, weil die Regierung es nicht schafft, genug Strom für das Land zu produzieren. Für mich ärgerlich, weil meine Ananas im Kühlschrank schrumpelig wird. Für jeden kleinen Unternehmer eine Katastrophe. Die Regierung verspricht Linderung und jagt in all ihren Parolen und Programmen dem Phantom „Fortschritt“ hinterher. Ich kann mich nur wundern über die Leichtgläubigkeit der Menschen, die bei jeder Wahl diesem Haufen von Lügnern ihre Stimme gibt.

Früher oder später wird es Ärger geben?
2008 wurde der damalige Premierminister Edmund Lowassa seines Amtes enthoben, weil er sich bei einem vorgetäuschten Deal mit einem amerikanischen Stromkonzern bereichert hat. Er hat mit der Firma Dowans einen millionenschweren Vertrag abgeschlossen, um Turbinen für die Stromproduktion zu erwerben. Nachdem über Jahre hinweg Zahlungen von der tansanischen Regierung an diese Firma getätigt wurden, stellte sich heraus, dass es diese Firma gar nicht gibt, und dass ein Großteil des Geldes in der privaten Tasche des Premierministers gelandet war. Strom wurde dabei aus versehen mal eben keiner produziert. Das ist es, was man sich von dieser Regierung in Sachen Problemlösung erwarten darf. Lowassa aber hat heute nach wie vor seinen Sitz im Parlament und frisst sich mit seinen Diäten fett und fetter. Warum, liebe Tansanier, verjagt ihr diesen Mann nicht aus dem Parlament? Ist es euch noch nicht offensichtlich genug, das ihr hier verarscht werdet?
Hier ist das Problem vielleicht Bildung. Wer nicht Bescheid weiß über die Möglichkeiten einer Demokratie, den kann man leicht glauben machen, die Regierungspartei sei die einzige Kraft im Lande, die es überhaupt irgendwie schaffen kann, den „Fortschritt“ anzukurbeln. Einen Zusammenhang zwischen der Dauerregierung der CCM und dem zunehmend schlechteren Zustand des Landes scheint hier niemand herzustellen.
Was soll der weiße Mann nun machen? Ist es meine Aufgabe hier eine Lösung vorzuschlagen? Braucht Tansania noch mehr NGOs, westliche „Entwicklungshilfe“, politische Berater und andere Pfuscher? Ich glaube, die Lösung ist schon hier, nur benutzt sie keiner so richtig: Demokratie. Die Menschen hier haben es selber in der Hand. Um eine andere politische Führung zu wählen brauchen sie nichts von uns. Ich freue mich auf den Tag, an dem Tansania einen politischen Umschwung erlebt. Aber gleichzeitig habe ich auch Angst. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die alteingesessenen Eliten eine Abfuhr durch die Wähler einfach so hinnehmen werden. Wahrscheinlich ist der einzige Grund, warum Tansania noch keinen Bürgerkrieg durchlitten hat die Tatsache, dass die Tansanier so schrecklich unorganisiert sind. Hat ja auch sein Gutes.
Mit diesem Gedanken bin ich wieder versöhnt. Habe ein bisschen Druck aus der Gehirnrinde abgelassen. Ein Mann, der viel schlauer ist als ich, und wahrscheinlich auch besser verdient, hat einmal gesagt: „One of the rewards of deep thought is the hot glow of anger at discovering a wrong, but if anger is taboo, thought will starve to death“ (Jules Henry). Jetzt habe ich mich also satt geärgert. Vielen Dank fürs mitärgern, ich hoffe, es liegt nicht zu schwer im Magen. Zum Abschluss dieses schrecklichen Textes, als Nachtisch sozusagen, noch ein paar klebrig schöne Wörter: Plebiszit. Gewerbegebiet. Holzgang. Auf Wiedersehen.
Es tut mir in der Seele weh zu sehen, wie meine Freunde sich Tag für Tag abrackern und doch nie, nie, nie von der Stelle kommen werden. Wie sie ihre Kinder gerade mal mit dem nötigsten versorgen und schon an ein paar Schillingen für Schulbücher scheitern. Wie sie an Krankheiten leiden, die bei uns in Deutschland mit Tabletten für ein paar-Mark-und-fufzig aus der Welt geräumt wären. Wie sie von ihren politischen Führern herabgewürdigt, von der Stadtverwaltung verjagt, von ihren Mitbürgern verachtet werden.
Es ist mir peinlich, wenn sie mich fragen, ob es bei uns in Deutschland auch Arme gibt. Ich denke an die Hartz-IV-Diskussionen und trau mich gar nicht zu sagen, dass wir vom Staat bezahlt werden, wenn auf dem Arbeitsmarkt mal nix geht. Die Armut, mit der ich hier konfrontiert bin, bereitet mir körperliche Schmerzen, schlaflose Nächte, einen Klos im Hals, einen Druck im Kopf, dass ich am liebsten zerspringen will. Dabei ist der Reichtum dieses Landes allgegenwärtig. Ich sehe eine Millionenstadt voller junger, kraftvoller Menschen, die arbeiten wollen, aber keine Chance bekommen. Wieso kommt Tansania nicht aus diesem absurden Zustand der Armut heraus?
„Maji yanafuata mkondo“ sagt man mir, das Wasser folgt dem Flusslauf. So einfach. Die Lebenswege gleichen sich. Der Vater als armer Tropf vom Dorf in die Stadt gekommen. Dort ein Leben lang geschuftet. Erst Plastiktüten auf dem Markt verkauft, später mit einem Karren die Einkäufe der Besserverdienenden durch die Stadt befördert. Gebrauchte Kinderkleider zum Verkauf durch die Straßen getragen. Oder Schuhe, Zigaretten, Rattengift. Als der Körper im Alter müde wurde eine kleine Holzbude am Straßenrand, Schuhe putzen, bis er blind wird und ihm die Zähne ausfallen. Aber was heißt hier im Alter? Die durchschnittliche Lebenserwartung in Tansania beträgt irgend so etwas wie 58 Jahre. Da spricht man bei uns noch vom „zweiten Frühling“ und plant die Weltreise, die man als junger Mensch verpasst hat. Krankenversicherung und Gesundheitsvorsorge gibt es hier nicht. „Wir sind nicht wie die wazungu, die Weißen. Wir gehen nicht zum Arzt, um mal zu sehen wie es so um die Gesundheit steht,“ sagen meine Freunde auf der Straße. Sie werden eines einfach Tages krank, vielleicht klappen sie auch komplett zusammen und sterben einfach ein paar Tage später.
„Wenn einer von uns krank wird, dann legen wir zusammen, um ihn ins Krankenhaus zu schicken.“ Das machen die Jungs aber nicht beliebig oft. „Wenn wir sehen, nach ein oder zwei Krankenhausbesuchen wird es nicht besser, legen wir zusammen für ein Busticket nach Hause ins Dorf.“ Im Dorf gibt es dann außer dem „mganga“, dem Medizinmann, ansonsten keine Behandlung mehr. Aber wenigstens ist man im Kreis der Familie. „Viele haben wir schon so nach Hause geschickt. Keiner ist wiedergekommen,“ sagte mir einmal mein Freund M. kopfschüttelnd.

Hinterhof in Tandika, Daressalam.
Erst vor einigen Tagen starb das wenige Monate alte Kind eines meiner Freunde. Ein paar Tage später das Neugeborene eines anderen Freundes. Schon das Zweite. Die Ärzte hier kennen Malaria und Antibiotika, wenn das nicht hilft, sind die Leute auf sich selbst gestellt. Ich habe noch nie so viele Leute um mich herum sterben gesehen.
Das alles macht mir Angst. Die strukturelle Armut hier lässt sich nicht mit ein paar Finanzspritzen aus der Welt schaffen. Die Armut betrifft nicht nur die Körper der Menschen, sondern auch ihren Geist. Alles dreht sich hier ums Geld. Jedes Gespräch, jeder Lebenstraum, jede soziale Beziehung hat, explizit oder nur unterschwellig, Geld zum Thema. Frauen sind bei ihrer Partnerwahl voll und ganz auf dessen finanzielle Perspektiven fixiert. Da keiner konstant Geld nach Hause schaffen kann, ist es nicht unüblich, mehrere Partner zu haben. Die Grenzen zur Prostitution sind oft fließend. Und weil tansanische Männer richtige Männer sein wollen, sind Kondome natürlich tabu für sie. Ungewollte Schwangerschaften führen zu Kindern, um die sich keiner kümmert. HIV/AIDS zerstört die Leben von Millionen Menschen. Aber das scheint den ganzen Kerlen hier egal zu sein. Tut mir leid, liebe Tansanier, aber das sind keine Folgen des Kolonialismus und das hat auch nichts mit dem kapitalistischen Weltsystem zu tun. Ihr macht euch selbst kaputt mit eurer Ignoranz.
Ich habe gesagt, es wird nicht schön diesmal. Die Fixierung auf Geld und den eigenen Vorteil zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Was am oberen Ende der Gesellschaft wie selbstsüchtige Kleptomanie aussieht, ist in der Mitte und am unteren Ende Diebstahl, Lüge, Betrug aus Angst, aus Verzweiflung, aus der Hoffnung heraus, sich einen kleinen Vorteil in dieser Schlangengrube von Gesellschaft zu verschaffen. Es herrscht das Recht des Stärkeren in Tansania.
Schön zu beobachten beispielsweise im Straßenverkehr. Ich kriege das kalte Kotzen wenn ich auf dem Weg in die Stadt von den Autos nur so gejagt werde. Wer würde es in Deutschland wagen mit dem Auto auf dem Bürgersteig zu fahren, und dann auch noch die Frechheit zu haben, Fußgänger mit der Hupe zu verscheuchen? Hier ganz alltäglich, und die Leute um mich herum sehen noch nicht mal einen Anlass, sich bei den Auto-Prolos zu beschweren. Sie sind es anscheinend gewohnt, keine Rechte zu haben. In Deutschland, so denke ich, haben wir eine Kultur, in der wir versuchen sozial schwächere irgendwie mitzutragen. Seine privilegierte Position nach außen zu kehren und sich als Macker zu geben gilt uns irgendwie als peinlich. Ich käme nie auf die Idee einen Behinderten auf der Straße auszulachen oder mich über den Nachteil eines anderen zu freuen. In Tansania dagegen gilt ein einfaches Prinzip: Der große Fisch frisst den kleinen.
Wer könnte einen Ausweg schaffen aus dem Teufelskreis aus Armut, erbärmlicher Bildung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, ungeplanten Schwangerschaften, AIDS? Wie wäre es mit der Regierung? Aber welches Interesse kann eine Regierung daran haben, ihre Bevölkerung zu bilden und zu mündigen Bürgern zu machen? Wenn die Tansanier endlich die Fußball-Zeitschriften aus der Hand legen und die Politikseiten ihrer Zeitungen lesen würden wäre das sicher nicht zum Besten der „Chama cha Mapinduzi“, der „Partei der Revolution“. Sie ist seit der Unabhängigkeit 1962 an der Macht, also seit fünfzig Jahren. Die Netzwerke in diesem Alt-Herren-Club sind etabliert und ausgebaut, da möchte keiner daran rütteln. Sie werden seit Jahrzehnten von ausländischen Finanzhilfen gespeist.
Und die desolate Lage der Bevölkerung betrifft diese Leute natürlich nicht: Ihre Kinder studieren in Oxford und Yale. Und wenn einer von ihnen krank wird, geht er nicht ins staatliche Krankenhaus und wartet fünf Stunden bis er den unterbezahlten Arzt bestechen darf, sondern fliegt nach Europa oder die USA, auf Staatskosten, versteht sich. Warum also, sollten sie etwas am Zustand ihres Landes ändern wollen? Es funktioniert doch super!
Die sambische Autorin Dambisa Moyo würde vorschlagen, den afrikanischen Regierungen den finanziellen Hahn zuzudrehen. Was als Marshall-Plan für das Nachkriegseuropa gut funktioniert hat, nämlich durch finanzielle Hilfe von außen eine nachhaltige Entwicklung zu stimulieren, geht in Afrika voll und ganz nach hinten los. Denn während der Marshall-Plan auf fünf Jahre begrenzt war, haben die afrikanischen Regierungen die Gewissheit, ohne zeitliches Limit Jahr für Jahr Millionensummen auf ihre Konten überwiesen zu bekommen. Warum also auch nur versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen? Und das Gutmenschentum in Europa und den USA wiederum denkt, wir müssten unsere sogenannte „Entwicklungshilfe“ auch noch aufstocken, um endlich die Armut für immer zu besiegen. Die einzigen die etwas davon haben, sind die Politeliten, bei den Menschen auf der Straße kommt kein einziger Cent an.
So sitzt Tansania nach fünfzig Jahren Unabhängigkeit jeden zweiten Tag im Dunkeln, weil die Regierung es nicht schafft, genug Strom für das Land zu produzieren. Für mich ärgerlich, weil meine Ananas im Kühlschrank schrumpelig wird. Für jeden kleinen Unternehmer eine Katastrophe. Die Regierung verspricht Linderung und jagt in all ihren Parolen und Programmen dem Phantom „Fortschritt“ hinterher. Ich kann mich nur wundern über die Leichtgläubigkeit der Menschen, die bei jeder Wahl diesem Haufen von Lügnern ihre Stimme gibt.

Früher oder später wird es Ärger geben?
2008 wurde der damalige Premierminister Edmund Lowassa seines Amtes enthoben, weil er sich bei einem vorgetäuschten Deal mit einem amerikanischen Stromkonzern bereichert hat. Er hat mit der Firma Dowans einen millionenschweren Vertrag abgeschlossen, um Turbinen für die Stromproduktion zu erwerben. Nachdem über Jahre hinweg Zahlungen von der tansanischen Regierung an diese Firma getätigt wurden, stellte sich heraus, dass es diese Firma gar nicht gibt, und dass ein Großteil des Geldes in der privaten Tasche des Premierministers gelandet war. Strom wurde dabei aus versehen mal eben keiner produziert. Das ist es, was man sich von dieser Regierung in Sachen Problemlösung erwarten darf. Lowassa aber hat heute nach wie vor seinen Sitz im Parlament und frisst sich mit seinen Diäten fett und fetter. Warum, liebe Tansanier, verjagt ihr diesen Mann nicht aus dem Parlament? Ist es euch noch nicht offensichtlich genug, das ihr hier verarscht werdet?
Hier ist das Problem vielleicht Bildung. Wer nicht Bescheid weiß über die Möglichkeiten einer Demokratie, den kann man leicht glauben machen, die Regierungspartei sei die einzige Kraft im Lande, die es überhaupt irgendwie schaffen kann, den „Fortschritt“ anzukurbeln. Einen Zusammenhang zwischen der Dauerregierung der CCM und dem zunehmend schlechteren Zustand des Landes scheint hier niemand herzustellen.
Was soll der weiße Mann nun machen? Ist es meine Aufgabe hier eine Lösung vorzuschlagen? Braucht Tansania noch mehr NGOs, westliche „Entwicklungshilfe“, politische Berater und andere Pfuscher? Ich glaube, die Lösung ist schon hier, nur benutzt sie keiner so richtig: Demokratie. Die Menschen hier haben es selber in der Hand. Um eine andere politische Führung zu wählen brauchen sie nichts von uns. Ich freue mich auf den Tag, an dem Tansania einen politischen Umschwung erlebt. Aber gleichzeitig habe ich auch Angst. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die alteingesessenen Eliten eine Abfuhr durch die Wähler einfach so hinnehmen werden. Wahrscheinlich ist der einzige Grund, warum Tansania noch keinen Bürgerkrieg durchlitten hat die Tatsache, dass die Tansanier so schrecklich unorganisiert sind. Hat ja auch sein Gutes.
Mit diesem Gedanken bin ich wieder versöhnt. Habe ein bisschen Druck aus der Gehirnrinde abgelassen. Ein Mann, der viel schlauer ist als ich, und wahrscheinlich auch besser verdient, hat einmal gesagt: „One of the rewards of deep thought is the hot glow of anger at discovering a wrong, but if anger is taboo, thought will starve to death“ (Jules Henry). Jetzt habe ich mich also satt geärgert. Vielen Dank fürs mitärgern, ich hoffe, es liegt nicht zu schwer im Magen. Zum Abschluss dieses schrecklichen Textes, als Nachtisch sozusagen, noch ein paar klebrig schöne Wörter: Plebiszit. Gewerbegebiet. Holzgang. Auf Wiedersehen.
lekke - 20. Apr, 13:54




 „Mist, jetzt haben wir vergessen Wasser zu kaufen,“ sagt C., als wir gerade aus dem dünn besiedelten Chamazi am Rande der Stadt in den Busch laufen, um die kleine Scholle zu suchen, die er und sein Cousin M. gemeinsam von ihrer Tante gekauft haben. Vor uns tut sich eine sanfte und grüne Hügellandschaft auf, und ich bereue nicht, die Einladung angenommen zu haben, die beiden zu ihrem Zukunfts-Hoffnungs-Ort zu begleiten. Das mit dem Wasser nehme ich nicht so ernst, ich prahle noch mit meiner vortrefflichen körperlichen Konstitution, was ich später kleinlaut und unter mitleidigem Schulterklopfen revidieren werde. Wir überqueren eine Senke um auf der anderen Seite das besagte Stück Land zu finden. Ihre Tante begleitet uns. Ihr Ehemann war der Besitzer und Verwalter des Landes, und hatte bereits einige Parzellen verkauft, bevor er letzten Dezember starb. Als wir ankommen torkelt sie zunächst wie betrunken durch die Hitze, bis sie sich schließlich im Schatten eines Baumes auf die verbrannte Erde wirft und vor Kummer und Schmerz schreit. Dieser einfache Acker weckt Erinnerungen in ihr, an ein gemeinsames Leben mit ihrem Mann, das erst vor so kurzer Zeit endete. Etwas unbeholfen stehen wir drei um sie herum, bis M. sie schließlich bittet, sich nicht in den Dreck zu legen, es gebe ziemlich viel garstiges Ungeziefer.
„Mist, jetzt haben wir vergessen Wasser zu kaufen,“ sagt C., als wir gerade aus dem dünn besiedelten Chamazi am Rande der Stadt in den Busch laufen, um die kleine Scholle zu suchen, die er und sein Cousin M. gemeinsam von ihrer Tante gekauft haben. Vor uns tut sich eine sanfte und grüne Hügellandschaft auf, und ich bereue nicht, die Einladung angenommen zu haben, die beiden zu ihrem Zukunfts-Hoffnungs-Ort zu begleiten. Das mit dem Wasser nehme ich nicht so ernst, ich prahle noch mit meiner vortrefflichen körperlichen Konstitution, was ich später kleinlaut und unter mitleidigem Schulterklopfen revidieren werde. Wir überqueren eine Senke um auf der anderen Seite das besagte Stück Land zu finden. Ihre Tante begleitet uns. Ihr Ehemann war der Besitzer und Verwalter des Landes, und hatte bereits einige Parzellen verkauft, bevor er letzten Dezember starb. Als wir ankommen torkelt sie zunächst wie betrunken durch die Hitze, bis sie sich schließlich im Schatten eines Baumes auf die verbrannte Erde wirft und vor Kummer und Schmerz schreit. Dieser einfache Acker weckt Erinnerungen in ihr, an ein gemeinsames Leben mit ihrem Mann, das erst vor so kurzer Zeit endete. Etwas unbeholfen stehen wir drei um sie herum, bis M. sie schließlich bittet, sich nicht in den Dreck zu legen, es gebe ziemlich viel garstiges Ungeziefer.  „Abdullah hat ein Stück von der Palme dort drüben bis zu dem Yamsbusch dort, und von dem Lehmbrocken auf der anderen Seite bis zum Wasser unten. Das heißt auf der anderen Seite ist das Stück von Patrick, und dahinter dann unseres, ungefähr bis zu dem Mangobaum da hinten.“ Das ganze sind dann etwa 30 auf 60 Fuß, und unser Maßband ist in Metern geeicht. Wasser haben wir wie gesagt keines, dafür knapp 40 Grad im Schatten, nur dass es eben keinen Schatten gibt. Ein lustiger Nachmittag steht uns bevor.
„Abdullah hat ein Stück von der Palme dort drüben bis zu dem Yamsbusch dort, und von dem Lehmbrocken auf der anderen Seite bis zum Wasser unten. Das heißt auf der anderen Seite ist das Stück von Patrick, und dahinter dann unseres, ungefähr bis zu dem Mangobaum da hinten.“ Das ganze sind dann etwa 30 auf 60 Fuß, und unser Maßband ist in Metern geeicht. Wasser haben wir wie gesagt keines, dafür knapp 40 Grad im Schatten, nur dass es eben keinen Schatten gibt. Ein lustiger Nachmittag steht uns bevor. Hoffnung lauert jedoch unten am Bach. Nachdem die eigentliche Arbeit vollbracht ist, werfen C. und M. sich ihre Hacken über die Schulter und lassen ihre Tante und mich Weichei unter einem Baum zurück. Nach wenigen Minuten kommen sie grinsend mit etwas wieder, was für mich wie Bambus aussieht. Nachdem wir aber mühsam mit den Zähnen die harte Rinde abgenagt haben gibt das zuckrig-kristalline Mark den süßen Geschmack von Wassermelone und vor allem etwas Flüssigkeit preis. Ich kann mich gerade noch zurückhalten den beiden heulend um den Hals zu fallen. Das Zuckerrohr hacken sie in etwas handlichere Stücke und verschnüren es mit der abgezogenen Rinde eines Baums für den Heimtransport. Ich staune über die beiden von neuem. Sind halt doch echte „Naturburschen“, Jungs vom Land, vom Dorf. Die Sonne und die körperliche Arbeit machen ihnen nicht die Bohne aus.
Hoffnung lauert jedoch unten am Bach. Nachdem die eigentliche Arbeit vollbracht ist, werfen C. und M. sich ihre Hacken über die Schulter und lassen ihre Tante und mich Weichei unter einem Baum zurück. Nach wenigen Minuten kommen sie grinsend mit etwas wieder, was für mich wie Bambus aussieht. Nachdem wir aber mühsam mit den Zähnen die harte Rinde abgenagt haben gibt das zuckrig-kristalline Mark den süßen Geschmack von Wassermelone und vor allem etwas Flüssigkeit preis. Ich kann mich gerade noch zurückhalten den beiden heulend um den Hals zu fallen. Das Zuckerrohr hacken sie in etwas handlichere Stücke und verschnüren es mit der abgezogenen Rinde eines Baums für den Heimtransport. Ich staune über die beiden von neuem. Sind halt doch echte „Naturburschen“, Jungs vom Land, vom Dorf. Die Sonne und die körperliche Arbeit machen ihnen nicht die Bohne aus.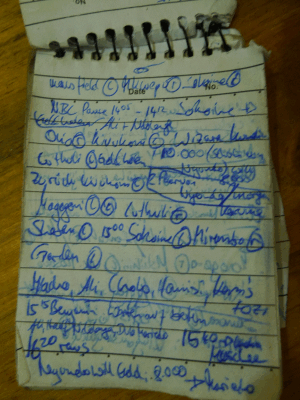
 J. war keiner von den Schuhverkäufern. Er hat mit zwei anderen Jungs einen kleinen „Buchladen“ betrieben, genaugenommen ein Stahlgitter, das mit gebrauchten Büchern vollbeladen war. Wenn sie Glück hatten, die drei, kam ein Schüler oder Student vorbei, und hat ihnen ein Geschichtsbuch oder einen Atlas abgekauft.
J. war keiner von den Schuhverkäufern. Er hat mit zwei anderen Jungs einen kleinen „Buchladen“ betrieben, genaugenommen ein Stahlgitter, das mit gebrauchten Büchern vollbeladen war. Wenn sie Glück hatten, die drei, kam ein Schüler oder Student vorbei, und hat ihnen ein Geschichtsbuch oder einen Atlas abgekauft. 


